
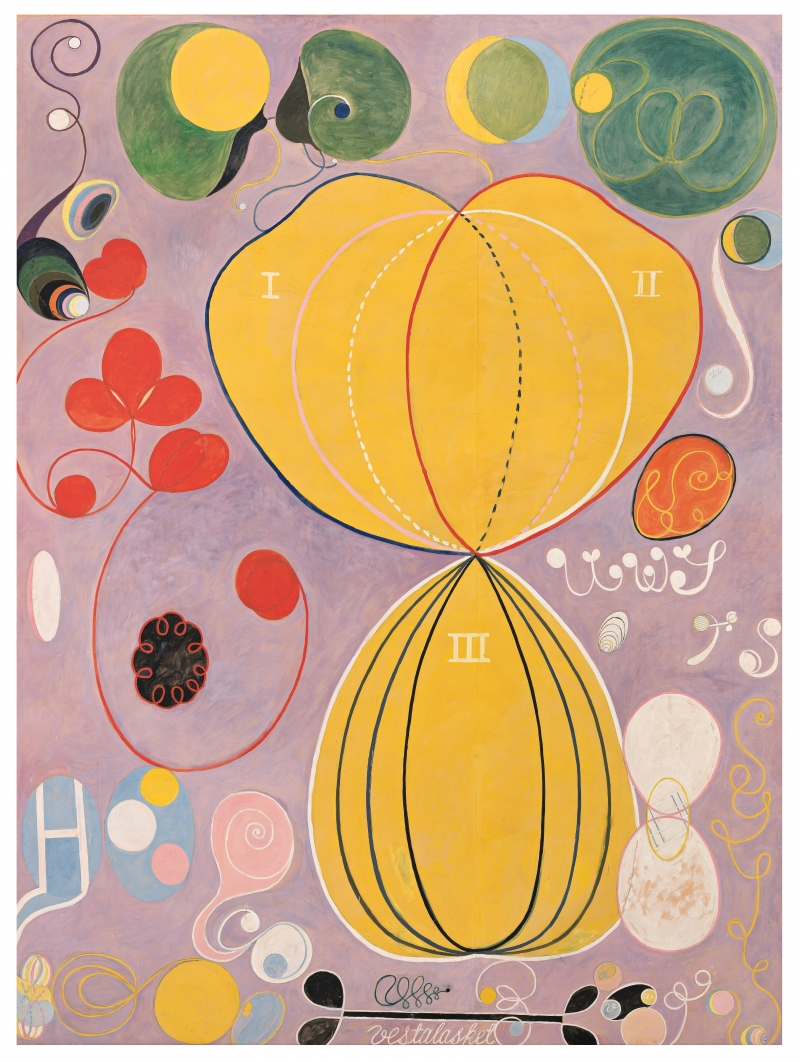
Lange unbekannt, gilt die Schwedin Malerin Hilma af Klint (1862–1944) heute als eine der Pionierinnen der abstrakten Malerei. In der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (K20) werden ihre Werke in einer großen Ausstellung nun erstmals mit denen von Wassily Kandinsky zusammengeführt. Katrin Schmersahl nimmt diese Schau zum Anlass, Ihnen die Künstlerin und ihr Umfeld in einem Seminar näherzubringen.

Entdecken Sie bei einer Führung mit Dagmar Lott die revolutionären Neuerungen der Kunst der Klassischen Moderne. Sehen Sie Meisterwerke von Edvard Munch bis Max Ernst, Richtungen wie Expressionismus, Kubismus, Abstraktion, und erfahren Sie, wie Sammlermut und Museumsvisionen die Moderne in die Hamburger Kunsthalle brachten.

Rot, die machtvollste aller Farben, prägt seit jeher unsere Welt. Sie ist Symbol für Leben und Liebe, Leidenschaft und Revolution, Blut und Tod. Erkunden Sie innerhalb der Seminarreihe »Die Farben der Kunst« zusammen mit Alice Gudera und Florian Britsch die faszinierende Kunst- und Kulturgeschichte der Farbe Rot von der Antike bis zur Gegenwart.

Bei einer Führung mit Dorith Will erkunden Sie die Geschichte der Landschaftskunst anhand der Sammlung der Hamburger Kunsthalle. Beginnend mit der Romantik Caspar David Friedrichs erleben Sie den Wandel der Gattung bis hin zu zeitgenössischen Positionen wie Jakob Kudsk Steensens aktueller digitaler Installation The Ephemeral Lake.

Die Kunsthalle zeigt die erste museale Einzelausstellung der Rosa-Schapire-Kunstpreisträgerin Kathleen Ryan. Erfahren Sie bei einer Führung mit der Assistenzkuratorin Ifee Tack mehr über die doppelsinnige, zwischen Glanz und Vergänglichkeit changierende Kunst der US-Amerikanerin.

Diese 5-tägige Reise mit Uwe Bölts führt uns in die Mitte Mecklenburgs und bietet einen faszinierenden Einblick in die Architektur der Backsteingotik. Auf unserer Fahrt durch die reizvolle mecklenburgische Landschaft entdecken wir unbekannte Dorf- und Stadtkirchen, besuchen aber auch einige der bedeutendsten Backsteinbauten Norddeutschlands, darunter die Marienkirche in Rostock und die Klosterkirche in Bad Doberan.